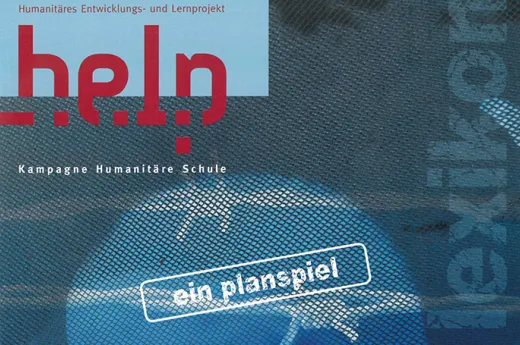
Humanitäre Schule
Schüler bringen sich gegenseitig die Grundlagen des Völkerrechts bei.
Die Lage ist ernst: Mehr als eine halbe Million Menschen sind schon geflüchtet aus Lufar, einer Provinz des afrikanischen Staates Malea. Die Zentralregierung hat Milizen beauftragt, die mit mörderischer Härte gegen die „Freies Lufar“-Rebellen und gegen Männer, Frauen, Kinder vorgehen. Maleas Nachbarstaat Nongi kann kaum noch Flüchtlinge aufnehmen. Jetzt soll ein Unterausschuss der Vereinten Nationen helfen. Malea, Nongi und Lufar werdet ihr in keinem Atlas finden. Denn sie sind eine Idee des Landesverbandes Niedersachsens für das Planspiel „help“ (kurz für Humanitäres Entwicklungs-und LernProjekt). „help“ ist eingebettet in das Projekt „Humanitäre Schule“, das der Landesverband 2004 aus der Taufe hob – „ursprünglich für ein Jahr“, sagt Landesreferentin Nadine Lüdeling, die „help“ mitentwickelt hat. Doch die „Humanitäre Schule“ traf den Nerv der Zeit und läuft bis heute. Über 50 Schulen nahmen allein im vergangenen Schuljahr das kostenlose Angebot in Anspruch. Das Konzept: Drei Schüler pro Schule erhalten eine Ausbildung zum „Humanitären Scout“. Sie leiten im Anschluss das Planspiel „help“. Dann führen sie ein Projekt an ihrer Schule oder in ihrem Ort durch. Am Schuljahresende erhalten die teilnehmenden Schulen – im Rahmen einer großen Feier – ein Zertifikat. Der Schlüssel zum Erfolg ist für Nadine folgender: „Die Lehrer erhalten auf dem Silbertablett eine Arbeitsgrundlage, Theorie, Planspiel und praktische Umsetzung vor Ort.“ Das Prinzip von „help“ „ist ein peer-to-peer-Ansatz, in dem Gleichaltrige voneinander lernen“, erklärt Nadine. Die Schüler müssen gemeinsam an einen Verhandlungstisch. Sie mimen Vertreter der beteiligten afrikanischen Länder, Deutschlands, des Internationalen Rotkreuz-Komitees, der Vereinten Nationen und der Presse. „Das machen die Schüler in einer Nacht, an einem Tag oder an zwei bis drei Vormittagen“, sagt Nadine. Nach „help“ sollen die Teilnehmer humanitäres Engagement vor Ort umsetzen. „Schüler sollen selbst Ideen entwickeln,
deswegen ist die Vorgabe auch nicht JRK-orientiert“, sagt Nadine. Ob sie nun der örtlichen Tafel helfen oder eine Schulpatenschaft aufbauen, ein Konzert auf die Beine stellen oder ein Fußballturnier – ganz egal. Wenn sie dabei am Ende eine positive Erfahrung mit dem JRK verknüpfen – umso besser. Das ist aber nicht das Hauptziel. „Die Mitgliederzahlen steigern wir damit nicht und wirtschaftlich kommt kein Gewinn heraus. Aber die Begeisterung springt über“, sagt Nadine. Damit sei ein zentraler Auftrag des JRK - die Verbreitung des humanitären Völkerrechts – erfüllt. Und genau dieser Gedanke müsse im Vordergrund stehen.
Der Landesverband Niedersachsen hat in den vergangenen drei Jahren jeweils 50 Schulen das Zertifikat „Humanitäre Schule“ verliehen. Viele Schulen sind Wiederholungstäter, es kommen aber jährlich etwa zehn neue dazu. Landesreferentin Nadine Lüdeling weiß mehr. Tel: 0511/28000400. Mehr Infos zum Projekt findest Du unter www.humanitaereschule.de.
Neben Niedersachsen bieten – in kleinerem Rahmen – auch andere Landesverbände das Projekt „Humanitäre Schule“ an, darunter Westfalen-Lippe. Hajo Mußenbrock betreut das Projekt dort:
Hajo, dürfen die zertifizierten schulen mit der Auszeichnung werben?
Wenn sie clever sind, machen sie das. Das ist ein gutes Argument der Schulen im Konkurrenzkampf untereinander. Alles, was ein Alleinstellungsmerkmal ist, finden Eltern toll.
Inwiefern hältst du "Humanitäre Schule“ für nachhaltig?
Das Bewusstsein der Schüler ist verändert. Das werden sie weitergeben an Lehrer, ihre Eltern und später auch an ihre Kinder.
Und für das JRK?
Ich würde mir wünschen, dass das Thema Völkerrecht, das uns ja von allen anderen Jugendverbänden abhebt, bei unseren JRKlern genauso in Fleisch und Blut übergeht wie „Pflasterkleben“, das es in den Herzen und Köpfen ist und dort wächst.